Physch Aufgaben 26.3.98
Mit Lösungen
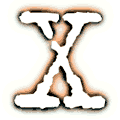
Physch Aufgaben 26.3.98Mit Lösungen |
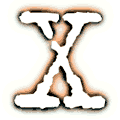 |
1. Es soll die unbekannte Induktivität L1 einer eisenfreien Spule gemessen werden. Zur Verfügung stehen: Ein Papierfolienkondensator, dessen Kapazität C zwischen 2 mF und 3 mF liegt, eine eisenfreie Spule bekannter Induktivität L2 = 90 mH, deren ohmscher Widerstand jedoch unbekannt ist, ein Sinusgenerator veränderbarer Frequenz und ein Amperemeter. Zeichnung
a) Es wird die abgebildete Schaltung hergestellt. Beim stetigen Übergang von niedrigen zu hohen Frequenzen zeigt das Amperemeter bei einer bestimmten Frequenz ein Maximum für die Effektivstromstärke. Begründen Sie diese Feststellung. Lösung
b) Bei Durchführung des Experiments mit der Induktivität L1 tritt das Stromstärkemaximum bei der Frequenz v1 = 55,3 Hz auf, bei Durchführung des Experiments mit der Induktivität L2 tritt das Stromstärkemaximum bei der Frequenz v1 = 1074 Hz auf. Berechnen Sie die Induktivität L1. Lösung
c) Berechnen Sie die Kapazität C des Kondensators. Lösung
d) Zur experimentellen Überprüfung der Ergebnisse von c) wird der Kondensator an die Netzspannung Ueff = 220 V angeschlossen. Im Stromkreis liegt ein Amperemeter. Welche Stromstärke muß erwartet werden ? Lösung
2. Ein Plattenkondensator hat quadratisch Platten der Seitenlänge a = 20 cm und den Plattenabstand d = 2mm. Der Plattenkondensator ist mit einem ohmschen Widerstand R = 1 MW hintereinander geschaltet. An die Schaltung wird ein Wechselspannung eines Sinusgenerators mit veränderbarer Frequenz angelegt. Die Effektivspannung ist Ueff = 15,0 V. Die Frequenz soll so eingestellt sein, daß die Effektivspannung Ueff,c am Kondensator gleich der Effektivspannung Ueff,R am Widerstand ist.
a) Berechnen Sie die Frequenz v für die oben genannten Bedingungen. Lösung
b) Wie groß ist die Effektivstromstärke Ieff im Stromkreis ? Lösung
c) Wie groß sind die Effektivspannungen Ueff,c und Ueff,R ? Lösung
d) Ein Mikroamperemeter mit dem Meßberich 100 mA hat für Wechselstrom einen Innenwiderstand in der Größenordnung 10 kW. Kann man die unter b) ermittelte Stromstärke mit diesem Mikroamperemeter messen ? Lösung
e) Ein stromdurchflossenes Voltmeter mit dem Messbereich 30 V hat für Wechselspannung den Innenwiderstand Ri = 30 kW. Können die unter c) berechneten Spannungen mit diesem Voltmeter gemessen werden ? Lösung
3. Ein Kathodenstrahloszilloskop wird nach dem angegebenen Schaltbild an die Wechselspannung U = U0 * sin(wt), w = 2p * 50 1/s angeschlossen.
Die beiden Kondensatoren haben die gleiche Kapazität C = 0,1 mF Die beiden Widerstände R sind gleich; sie sollen so gewählt werden, daß die Ströme IA und IB, die in den beiden Kreisen mit den Punkten A und B fließen, gegen die Spannung U die Phasenverschiebung j = -p/4 haben.
a) Berechnen Sie die Widerstände R. Lösung
b) Geben Sie die Terme für die Ströme IA und IB an. Lösung
c) Zeigen Sie: Die Spannungen UA und UB, die an den Punkten A und B gegen Erde vorliegen, genügen den Gleichungen
UA = ...
UB = ...
d) Ermitteln Sie daraus die Spannungen UA,B zwischen den Punkten A und B zu UA,B = -U0 *cos(wt). Lösung
e) Begründen Sie, daß das Oszilloskop auf dem Schirm einen Kreis zeigt. Lösung
4. Ein Drehkondensator hat bei vollständig herausgedrehten Platten (Drehwinkel = 0°) die Kapazität C1,min = 5,0 pF, bei vollständig hineingedrehten Platten die Kapazität C1,max = 200 pF. Bei dem Hineindrehen der Platten steigt die Kapazität mit dem Drehwinkel gleichmäßig von 5,0 pF auf 200 pF an. Dieser Kondensator wird mit dem Kondensator fester Kapazität parallel geschaltet. Die beiden Kondensatoren werden mit einer Spule der Induktivität L = 8,5 mH zu einem Schwingkreis verbunden. Um welchen Drehwinkel muß man die Platten des Drehkondensators hineindrehen, damit der Schwingkreis die Eigenfrequenz n0 = 125 kHz erhält ? Lösung
5. Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einer Hochfrequenzspule mit der Induktivität L1 = 5,5 mH und einem Drehkondensator. Bei vollständig herausgedrehten Platten (Drehwinkel 0°) beträgt die Kapazität des Drehkondensators Cmin = 10 pF, bei vollständig hineingedrehten Platten (Drehwinkel 180°) beträgt die Kapazität Cmax = 480 pF. Bei dem Hineindrehen der Platten steigt die Kapazität mit dem Drehwinkel gleichmäßig von 10 pF auf 480 pF an.
a) Berechnen Sie die größtmögliche Eigenfrequenz nmax des Schwingkreises. Lösung
b) Berechnen Sie die kleinstmögliche Eigenfrequenz nmin des Schwingkreises. Lösung
c) An dem oben beschriebenen Schwingkreis wird ein Resonanzkreis induktiv gekoppelt. Der Resonanzkreis besteht aus einenr Hochfrequenzspule mit der Induktivität L2 = 1,5 mH und einem Plattenkondensator mit kreisförmigen Platten. Der Plattenradius ist r = 13 cm, der Plattenabstand d = 0,2 cm. Zwischen den Platten befindet sich zunächst Luft. Für die Dielektrizitätszahl von Luft kann man er = 1. Um welchen Winkel a muß man die Platten des Drehkondensators hineindrehen, um Resonanz herzustellen ? Lösung
d) Nun wird der Raum zwischen den Platten des Plattenkondensators durch Hineinschieben einer Kuststoffplatte voll ausgefüllt. Jetzt muß man die Platten des Drehkondensators um den Winkel b = 69,8° hineindrehen, um Resonanz herzustellen.Welche Dielektrizitätszahl er,K des Kunststoffmaterials ergibt sich daraus ? Lösung
6) Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einem Kondensator der Kapazität C = 50 pF und einer Spule veränderbarer Länge l.Die Spule hat n = 60 Windungen mit dem Radius r = 0,75 cm und kann als lange Spule angesehen werden.
a) Welche Länge l1 muß die Spule haben, damit die Eigenfrequenz des Schwingkreises v1 = 10,0 MHz ist ? Lösung
b) Wie groß muß im Fall a) der Abstand zweier benachbarten Windungen ? Lösung
c) Durch Ausziehen der Spule läßt sich der Abstand zweier benachbarter Windungen auf d2 = 4,5 mm vergrößern, ohne daß sich der Radius der Windungen merklich ändert. Welche Eingenfrequenzen v2 wird durch ein derartiges Ausziehen erreicht ? Lösung
1. a) Bei der Schaltung handelt es sich um eine Siebkette.
1. b) Über die thomsonsche Schwingungsformel ( w²=1/(L*C) ) berechne man durch Benutzung von L2 zunächst C = 2,44 mF
Danach kann man nun über die selbe Formel auch L1 = 3,395 H berechnen.
1. c) Beim zurückrechnen ergibt sich wieder die Kapazität C = 2,44 mF
1. d) Über den kapazitiven Widerstand läßt sich berechnen (R=U/I), daß I = 0,16864 A ist.
2. a) Als erstes sollte man bei dieser Aufgabe C = 177,0836344 pF berechnen. Nun kann man die Effektivspannungen Ueff,C und Ueff,R gleichsetzen.
Ueff,C =Ueff,R // Ohmsches Gesetz R = U/I
XC * Ieff = R * Ieff // Ieff fällt weg !!
XC = R !!! => f = 898,7558 Hz
2. b) Über das Ohmsche Gesetz errechne ich dann auch Ieff. Die Effektivstromstärke beträgt Ieff = 1,06066·10-5 A. (O)
2. c) Da die beiden Effektivspannungen Ueff,C und Ueff,R gleich sind (Bedingung aus a), und auch Ieff überall gleich ist, muß nur eine Rechnung durchgeführt werden. Die Effektivspannungen betragen dann Ueff,C = Ueff,R = 10,6066 V. (O)
2. d) Ich würde sagen ja, weil der Innenwiderstand nur geringfügig von 1 MW auf 1,1 MW steigt (Reihenschaltung !) und da somit kaum eine Abweichung stattfindet.
2. e) Ich würde sagen nein, weil der Innenwiderstand den Gesamtwiderstand durch die Parallel-schaltung auf ca. 29 kW herabsetzt. Demnach ändert sich auch die Spannung.
3. a) Zunächst berechnet man den Blindwiderstand XC = 31830,989 W. Dies ist laut Bedingung gleich R.
3. e) Der Kreis entsteht dadurch, daß jeweils an einer der beiden Wege eine Phasenverschiebung von + bzw. - p/4 auftritt.
4. Die thomsonsche Schwingungsformel muß nach C umgestellt werden. Für C muß man dann C1 + C2 einsetzen und die Gleichung nach C1 = 90,7 pF auflösen. Über ein Verhältnisgleichung kann man dann den Drehwinkel (a = 79,128°) finden.
5.a) Über die thomsonsche Schwingungsformel läßt sich vmax berechenen, wenn man Cmin für das C einsetzt. Demnach ergibt sich: vmax = 21460448,15 Hz = 21,46 MHz.
5.b) Ebenso läßt sich vmin berechenen, wenn man Cmax für das C einsetzt. Nun ergibt sich: vmin = 3097548,879 Hz = 3097,458 kHz = 3,097 MHz.
5.c) Induktiv gekoppelt beteutet, daß beide Spulen über einen Eisenkern induktiv gekoppelt sind ! Demnach muß man einfach nur die Frequenz f = 8,47 MHz des Resonanzkreises berechnen und damit dann über C1 = 64,2 pF den Drehwinkel ( a = 20,75° ) zurückrechnen. (C2,Luft = 235,047 pF)
5.d) Über den Drehwinkel berechnet man zunächst die Kapazität des ersten Kondensators C1 = 192,2555 pF. Daraus ergibt sich die Frequenz des Resonanzkreises f = 4,894398 MHz. C2,Kunststoffplatte müßte demnach 704,9372 pF sein. Daraus ergibt sich nun für die Dielektrizitätszahl er,Kunststoffplatte ungefär 3.
6.a) Zuerst berechnet man über die Thomsonsche Schwingungsformel die Induktivität L = 5,066 mH der Spule. Dann kann man über die Formel zur Induktivität einer langgestreckten Spule (Formelsammlung Seite 21) die Länge l1 = 0,1577 m berechnen.
6.b) Der Abstand ist demnach d1 = l1/n = 2,63 mm
6.c) Durch das Ausziehen wird eine Eigenfrequenz von n2 = 13,080508562 MHz erreicht. (O)
Leider noch keine Lösung vorhanden.
Um dieses Dokument perfekt lesen zu können muß die Schriftart Symbol installiert sein.
Dieses Dokument ist Teil der Physchfiles. Es ist in mühevoller Kleinarbeit abgeschrieben und bearbeitet worden.Die obenstehenden Lösungen sind keinesfalls vollständig; Sie sollen lediglich zum Verständnis beitragen.
Einen besonderen Dank an Olaf Michel, der zusätzlich seine Lösungen bereit gestellt hat.
Ebenso ein MEGA Dankeschön an Stephan Herting für seine Hilfe bei Aufgabe 5d) und e) !
Fehler sind leider nicht auszuschließen !!!
Copyright C.W.Budde, J.-F. Schorr sowie (O)laf Michel
(c) by Ph-LK der Marienschule Abi-99